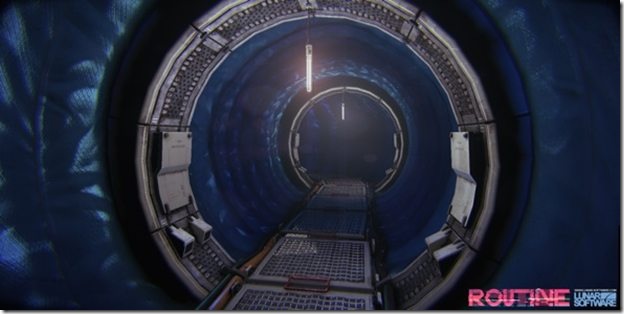Hier sitzen alle im Glashaus. Sehen hinein und schauen heraus – je nach Standpunkt auf der Bühne und in der Gesellschaft. Es ist ein determinierter Raum, aber gleichzeitig auch ein sehr fragiles Konstrukt. Es ist durchsichtig, aber es gewährt keine Einblicke in die Köpfe der hier so ausgestellt Handelnden. Es schützt und wärmt, aber es lässt auch das unwirtliche Außen hinein und offenbart permanent das Gefährdetsein. Und er führt vor, wie stark das hier Verhandelte von der Außenwelt abgekoppelt ist – und wie untrennbar es doch mit ihr verbunden scheint. Somit passt dieses Konservatorium, wie ein Wintergarten auf Englisch beziehungsvoll heißt, den Ausstatter Johannes Leiacker hier als Einheitsraum in der Frankfurter Oper für das Konversationsstück für Musik „Capriccio“ der Herren Richard Strauss und Clemens Kraus gebaut hat, perfekt zu diesem ambivalenten Opus.
Hier sitzen alle im Glashaus. Sehen hinein und schauen heraus – je nach Standpunkt auf der Bühne und in der Gesellschaft. Es ist ein determinierter Raum, aber gleichzeitig auch ein sehr fragiles Konstrukt. Es ist durchsichtig, aber es gewährt keine Einblicke in die Köpfe der hier so ausgestellt Handelnden. Es schützt und wärmt, aber es lässt auch das unwirtliche Außen hinein und offenbart permanent das Gefährdetsein. Und er führt vor, wie stark das hier Verhandelte von der Außenwelt abgekoppelt ist – und wie untrennbar es doch mit ihr verbunden scheint. Somit passt dieses Konservatorium, wie ein Wintergarten auf Englisch beziehungsvoll heißt, den Ausstatter Johannes Leiacker hier als Einheitsraum in der Frankfurter Oper für das Konversationsstück für Musik „Capriccio“ der Herren Richard Strauss und Clemens Kraus gebaut hat, perfekt zu diesem ambivalenten Opus.
Denn während Anno 1942 in Deutschland die Nazis den totalen Krieg mobilisierten, während gleichzeitig die ersten Städte (und, ja: auch Opernhäuser) im Bombenhagel niedersanken – was hier eine missglückte Diaschau des „brennenden Carthago“ konterkariert –, kümmert man sich in Garmisch, Wien und München in einer Art Vogel-Strauß-Haltung um einen kunstimmanenten Diskurs darüber, ob nun in der Oper den Worten oder der Musik der Vorzug zu gewähren ist. Personifiziert wird das durch die verwitwete Gräfin Madeleine, die sich in ihrem Salon zwischen den in sie verliebten Herren Olivier (Dichter) und Flamand (Komponist) zu entscheiden hat; was sie freilich auf „morgen mittag um elf“ vertagt hat, und somit das zwei Stunden zwanzig pausenlose Minuten dauernde Werk in herrlicher Dur-Schwebe und schönster, delikatester Strauss-Geigenapotheose enden lässt.

Fotos: Monika Rittershaus
Nicht so bei einer so klugen wie zupackenden, mit Strauss bestens vertrauten Regisseurin wie Brigitte Fassbaender, die auch die „Capriccio“-Schauspielerin Clairon in München und Glyndebourne gesungen hat. Die zeigt schon im stummen Vorspiel, wo wir hier sind: in einem Schloss bei Paris; aber eben nicht während des Reformopernstreites zur Gluck-Zeit, sondern in der Ära der „Capriccio“-Entstehung. Der kleiner Sohn des Haushofmeisters spielt in dem winterlich kargen Ambiente zwischen vertrockneten Topfpflanzen mit einem Panzer und einem Flugzeug, malt sich ein Hitlerbärtchen an und zeigt den Deutschen Gruß. Und im Finale, der illusionistisch gemalte Opernvorhang der Pariser Oper, der auch als Wiederholung die kleine Bühne am Ende des Raumes abschließt, hat sich vor ihrem großen Monolog als kontemplatives Zwischenatmen geschlossen, steht die Gräfin in Rokokorobe im nun perspektivisch fast ins Unendliche verlängerten Glaskasten, wo die Bühne gänzlich ferngerückt ist, und muss eine Entscheidung ganz anderer Tragweite fällen.
 Während ihr in die Schauspielerin Clairon verliebter Bruder samt den Theaterleuten längst wieder bei deren Bühnenangelegenheit weilt, zieht sie ihr Kostüm aus, einen Trenchcoat und eine Baskenmütze an, die ihr wiederum der Haushofmeister (feinsinnig: Gurgen Baveyan) reicht und begibt sich mit ihrer musizierenden Dienerschaft ebenfalls nach Paris. Doch in den Instrumentenkästen sind Waffen, die Mitverschwörer haben vorher „Liberation“-Plakate an die Glaswände gehalten, um sie zu ermahnen: Die Adelige hat sich für die Résistance entschieden. Hier werden wohl weder Worte noch Töne, sondern bald Projektile dominieren. Man könnte jetzt einwenden, Brigitte Fassbaender nobilitiere hier das Eskapismus-Musiktheater des greisen Strauss, der sich durchaus geschäftstüchtig als zeitweiliger Reichsmusikkammerpräsident vor den politischen Karren der Nazis hat spannen lassen, sie wasche ihn weiß. Aber sie betont durch diese dezente, aber sinnfällige Aktualisierung eigentlich nur die Doppelbödigkeit dieses immer wieder meisterlich starken, melancholieumflorten, menscheneinsichtigen Werkes, das freilich auch stetig seine theorielastig-hölzernen Durchhänger hat. Und hatte nicht auch Strauss eine jüdische Schwiegertochter und damit zwei jüdische Enkel zu schützen? Es gibt hier eben nicht nur Schwarzweiß, und die Regie zeigt das in vielen, subtilen Zwischentönen, die Spannung auch über den Kunstdiskurs hinaus halten.
Während ihr in die Schauspielerin Clairon verliebter Bruder samt den Theaterleuten längst wieder bei deren Bühnenangelegenheit weilt, zieht sie ihr Kostüm aus, einen Trenchcoat und eine Baskenmütze an, die ihr wiederum der Haushofmeister (feinsinnig: Gurgen Baveyan) reicht und begibt sich mit ihrer musizierenden Dienerschaft ebenfalls nach Paris. Doch in den Instrumentenkästen sind Waffen, die Mitverschwörer haben vorher „Liberation“-Plakate an die Glaswände gehalten, um sie zu ermahnen: Die Adelige hat sich für die Résistance entschieden. Hier werden wohl weder Worte noch Töne, sondern bald Projektile dominieren. Man könnte jetzt einwenden, Brigitte Fassbaender nobilitiere hier das Eskapismus-Musiktheater des greisen Strauss, der sich durchaus geschäftstüchtig als zeitweiliger Reichsmusikkammerpräsident vor den politischen Karren der Nazis hat spannen lassen, sie wasche ihn weiß. Aber sie betont durch diese dezente, aber sinnfällige Aktualisierung eigentlich nur die Doppelbödigkeit dieses immer wieder meisterlich starken, melancholieumflorten, menscheneinsichtigen Werkes, das freilich auch stetig seine theorielastig-hölzernen Durchhänger hat. Und hatte nicht auch Strauss eine jüdische Schwiegertochter und damit zwei jüdische Enkel zu schützen? Es gibt hier eben nicht nur Schwarzweiß, und die Regie zeigt das in vielen, subtilen Zwischentönen, die Spannung auch über den Kunstdiskurs hinaus halten.

Was auch an dem hervorragenden, einander wunderbar natürlich ergänzenden Ensemble liegt, mit dem Frankfurter Oper einmal mehr ihren größten Trumpf ausspielt. Der junge, nachdrücklich artikulierende Bariton Gordon Bintner ist ein unreifer, ungestümer, aber sympathischer Graf als flotter Reitersmann, der nur Augen für die Actrice Clairon hat, der die schwarzgekleidete Tanja Ariane Baumgartner mit fein lasiertem Mezzo jeden Anflug von Theaterdiva-Allüre versagt. AJ Glueckert mit hellem Tenor (Flamand) und der bissfeste Daniel Schmutzhard (Olivier) sind auf eine sehr heutige, leidenschaftliche, ja sinnliche Art in ihre Liebes- wie Kunsthändel verstrickt und geben den beiden Figuren plastische Kontur.
Auch der über einen inzwischen etwas trockenen Bass verfügenden Alfred Reiter als wirkliche Menschen in den Kulissen suchenden Theaterdirektor La Roche wird hier nicht nur zum Thesenträger; die von ihm seeehr liebevoll protegierte Tänzerin (Katharina Wiedenhofer) könnte jetzt die #MeToo-Debate anheizen, aber Brigitte Fassbaender belässt es beim weiblichen Augenzwinkern. Ebenso versagt sie dem zurückhaltenden italienischen Sängerpärchen (lebendig: Sidney Mancasola, Mario Chang) beinahe jede Klischee-Übertreibung. Und den schläfrigen, vergessenen Souffleur-Grottenolm Monsieur Taube adelt der immer noch stimmfrische Graham Clark zur zwielichtigen Figur zwischen Kollaborateur und Juden. Ja selbst die acht Diener, meistenteils Opernstudiomitglieder, gewinnen in ihrem Ensemblestückjuwel charakterliche Kontur und vokales Eigenleben.

Zusammengehalten und überstrahlt wird dieses Netzwerk menschlicher Beziehung, Konversation und Kommunikation freilich von Camilla Nylunds so leuchtend blonder wie subtiler Gräfin. Sie ist eine Madeleine, die nicht nur auf der Sahncremesopranspur säuselt, die hat auch scharfe Momente, was der Partie Tiefe und Relevanz gibt. Man hört die Souveränität und Autorität einer Salome, Sieglinde, Marie durch, aber da ist nur ein Hauch von Vibrato und ungewöhnlich viel Facettenreichtum. Und oftmals genügt auch nur ein Blick, um sie sofort wieder ins Zentrum zu rücken. Plötzlich bekommt auch ihr sonst oft nur schöner Schlussmonolog durch das Codewort „Souper“ Schärfe, Druck und Sprengkraft. Famos!

Sebastian Weigle und das Museumsorchester können ganz unaufgeregt begleiten, die Balance stimmt ganz ausgezeichnet. Man hat hier im Graben viel übrig für das von Strauss geforderte „Verstandestheater, Kopfgrütze, trockenen Witz!“. Man hätte sich aber gern noch mehr Rubati-Artikulation und – besonders im Auftakt-Sextett wie in der abschließenden Mondscheinmusik – mehr seidigen Streicherglanz gewünscht.
Das Divertimento „Prima la musica e poi le parole“von Antonio Salieri, auf das hier beständig angespielt wird, und das sogar gegen Mozarts „Schauspieldirektor“ den Kunstsieg davontrug, entstand übrigens im Auftrags Kaiser Josephs II. für ein „Frühlingsfest an einem Wintertage“. Die Uraufführung fand am 7. Februar 1786 in der Orangerie von Schloss Schönbrunn statt. Auch das ein Widerschein im Gefühlslabyrinth dieses Frankfurter Gewächshauses mit seinen frierenden Menschen und seinem so irisierenden wie irrealen Licht, das doch diesem „Capriccio“ einen ganz neuen Schein gegeben hat.
Der Beitrag „Capriccio“ in Frankfurt: Eine Strauss-Gräfin geht in die Résistance erschien zuerst auf Brugs Klassiker.