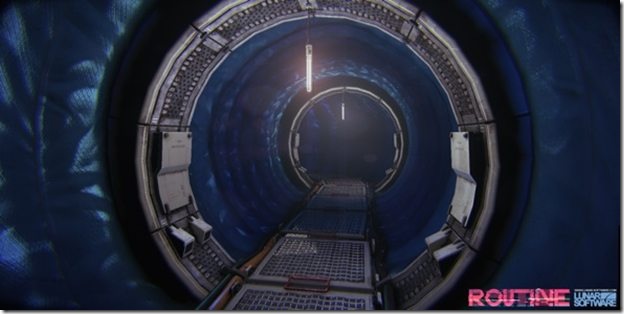Jonas Kaufmann singt Otello. Der Tenorissimo unserer Zeit in der größten (italienischen) Rolle jemals. Da sind wir also wieder. Eineinhalb Jahre später. Was im Juni 2017 mit sechs Aufführungen am Royal Opera House Covent Garden in London begann, setzt sich nun an der Bayerischen Staatsoper in München als Heimspiel fort. Besser geworden ist es freilich nicht. Noch immer ist das in Maßen enthusiasmierte, sich nur langsam applaussteigende Premierenpublikum mit einem seltsamen Widerspruch konfrontiert. Da spielt einer grandios einen ausgebrannten Typen, in ihm ist Leere statt Liebe, Verkrampfung statt Nonchalance, Unsicherheit statt Souveränität. Er krümmt und duckt sich, wütet, rast bisweilen und ist doch immer nur ein Würstchen. Und so klingt er auch, dumpf, monochrom, schon das anfängliche „Esultate“ der heroische Jubelruf des Löwen von Lepanto, der nun auch noch den eben tobenden Meersturm vor seiner zypriotischen Festung überstanden hat, tönt fahl, ohne Siegesgewissheit. So geht es weiter, die Stimme bricht fast im Piano, scheint sich nach innen zu wenden, ist ausgeglüht. Psychologisch mag das stimmig sein, aber tönt so ein Tenor-Feldherr? Natürlich, der alte Giuseppe Verdi hat da einen faszinierend gebrochenen Helden geschaffen, eine waidwunde Raubkatze. Aber um den zu demontieren, muss er erst einmal aufgerichtet werden.
Jonas Kaufmann singt Otello. Der Tenorissimo unserer Zeit in der größten (italienischen) Rolle jemals. Da sind wir also wieder. Eineinhalb Jahre später. Was im Juni 2017 mit sechs Aufführungen am Royal Opera House Covent Garden in London begann, setzt sich nun an der Bayerischen Staatsoper in München als Heimspiel fort. Besser geworden ist es freilich nicht. Noch immer ist das in Maßen enthusiasmierte, sich nur langsam applaussteigende Premierenpublikum mit einem seltsamen Widerspruch konfrontiert. Da spielt einer grandios einen ausgebrannten Typen, in ihm ist Leere statt Liebe, Verkrampfung statt Nonchalance, Unsicherheit statt Souveränität. Er krümmt und duckt sich, wütet, rast bisweilen und ist doch immer nur ein Würstchen. Und so klingt er auch, dumpf, monochrom, schon das anfängliche „Esultate“ der heroische Jubelruf des Löwen von Lepanto, der nun auch noch den eben tobenden Meersturm vor seiner zypriotischen Festung überstanden hat, tönt fahl, ohne Siegesgewissheit. So geht es weiter, die Stimme bricht fast im Piano, scheint sich nach innen zu wenden, ist ausgeglüht. Psychologisch mag das stimmig sein, aber tönt so ein Tenor-Feldherr? Natürlich, der alte Giuseppe Verdi hat da einen faszinierend gebrochenen Helden geschaffen, eine waidwunde Raubkatze. Aber um den zu demontieren, muss er erst einmal aufgerichtet werden.
Und das versagt sich und uns die Regisseurin Amélie Niermeyer total. Ganz im Regietheaterkonsens unserer ausgenüchterten Zeit ist ihr Otello ein unauffälliger Normalo in der momochromen Uniform eines Paketboten. Seine Desdemona erweist sich als liebende, störirische Frau, die auch ihre Ansprüche hat und den heimkehrenden, kriegstraumatisierten, sich nicht artikulierenden Mann nicht verstehen will oder kann. Natürlich ist dieser „Moro“ auch kein Schwarzer oder Nordafrikaner, jede rassistische oder politische Dimension, die bei Shakespeare noch sehr renaissance-zeitgeistig stark ist, bei Verdi/Boito schon abgeschwächt wurde, scheint hier ausradiert.
In München, in den immer wiederkehrenden, als Bildmetapher ausgelaugten, weil ewiggleichen, großbürgerlich kahlen Salons Christian Schmidts, findet eine vieraktige Zimmerschlacht als extensive Paartherapie statt. Die sich um die eigene Achse dreht, von Video-Zoomfahrten zusätzlich paralysiert wird. Schon das im Profil platzierte, immer anwesende Ehebett, das an eine freudianische Psychiatercouch gemahnt, ist ein optischer Wink mit dem Zaunpfahl.

Fotos: Wilfried Hösl
100 Shades of Hammershøi Grey. Kein Schwarz, kein Weiß, aber viele, feinabgestufte Grautöne, wie bei dem dänischen Maler rätselhaft melancholischer Interieurs. Angefangen mit den in ihren ostentativen Kontrasten sich abwechselnden, mal extrem weiblichen, in der definitiven Erniedrigung des großen Chortableau im dritten Bild freilich mit einem maskulinen Hosenanzug aufwartenden Desdemona-Kostümen Annelies Vanlaeres. Hier stäubt die erkaltete Asche eine Beziehung, bei nur noch ein sich den Arm am Kaminfeuer ansteckendes Desdemona-Double Funken sprüht, aber definitiv keine italienische Eifersuchtsoperntragödie.
Dafür erleben wir eine skandinavischen Mittelstand-Ehekrieg als Partnerduell à la Ibsen, Strindberg, Bergmann, sehr konzeptlastig, schon im ersten Bild, das als Zimmer im Zimmer die um den Mann bangende Desdemona zeigt. Ihr Sturm der Gefühle tobt im Inneren, auch längst so ein Regieklischee. Und das am Ende, zur Ermordung, wiederkehrt.
Hier hat ein Jago leichtes Spiel. Und man wundert sich nicht, dass Verdi mit dem Gedanken spielte, die Oper nach dieser dritten, sinistren Hauptfigur zu nennen. Der ungemein präsente, genaue, nuancenreiche Gerald Finley ist ganz schnell der Star: ein Jongleur des Bösen aus dem Geist der Commedia dell’Arte. Im Schlabbershirt, mit Streifenhosen, Sneakers und satansroten Socken ein teuflisch-galanter Verführer. Seinem Kavaliersbariton fehlt vokal die Schwärze, die Wucht, der Nihilismus. Er macht das durch zynisch wache Varianz und bewusste Textausdeutung wett. Immer wieder bettet er seinen Kopf in dem Schoß Otellos. Lief da mal was? Oder ist es nur Projektion? Einer der vielen, diffus bleibenden, letztlich kleinlichen Deutungsversuche Niermeyers.

Kein Italiener auch in der Restbesetzung. Die gut aufgelegten Chöre schmettern effektbewusst, so wie die Trompeten. Die immer noch anrührende, oft gehörte Desdemona der Anja Harteros hat inzwischen metallische Schärfen, ihr Timbre eine hier deutungsgerechte Härte und Herbheit bekommen. Vorangetrieben, an der kurzen Leine gehalten, extrem verlangsamt und ebenso beschleunigt wird sie von Kirill Petrenko. Der peitscht das Staatsorchester wie die Massen so vehement und knallig durch den blitzezuckenden, trommeldröhnenden Auftakt, dass der Lüster klirrt.
Ein infernalische Instrumentalfuror, der sich mit leise tastenden, lauernden Suspense-Momenten abwechselt. Immer wieder beschwört Petrenko gestenausgreifend die apokalyptischen Verdi-Extreme, nur tanzende Feuerraffinesse und gustiöser Trinkreigen, amouröse Wärme des ersten Duettfinales, die trügerische Madolinensonne im diesmal gendergestörten Idyll des zweiten Bildes, Resignation, verlorene Seelentrübnis des letzten Aktes, die findet sich nicht. Alles ist grell, zugespitzt, überzeichnet, schroff – ein brillanter, aber holzschnitthaft teutonischer Verdi in der vibratolos-harten, antikulinarischen Fritz-Busch-Tradition der Zwanzigerjahre.

Besonders in München als Traumpaar gefeiert, haben Anja Harteros und Jonas Kaufmann hier bisher in einer Wagner- und fünf italienischen Opern das Haus zum Beben gebracht. Die Bayerische Staatsoper ist das Epizentrum dieser sehr besonderen Sopran-Tenor-Konstellation. Der „Otello“ hätte jetzt als vierter Verdi-Pas de deux die Apotheose ihrer feinen Vokalbeziehung werden können. Es geriet eher zum Schwanengesang. Mit einer herben Spröden, die ihn nicht ranlässt, obwohl sie seine Nähe sucht. Und mit einem gereiften Frauenschwarm als Herr Niemand im lockenlos grauem Haar. Gemeinsam ratlos.
Es spricht für beide, dass sie sich hier als große Singschauspieler in den Dienst einer allzu einseitigen Deutung stellen. Die ist sauber, clean, aseptisch. Nicht verstörend, hart, politisch unkorrekt, wie jene Luc-Perceval-Inszenierung, mit der 2003 in der radikalen Neuübersetzung und Shakespeare-Zuspitzung Feridun Zaimoglus auf der anderen Maximilanstraßenseite Frank Baumbauer seine Kammerspiele-Intendanz eröffnet und der leider längst dem Theater abhanden gekommene Thomas Thieme einen verschmierten „Schoko“ auf die Bühne gewuchtet hat. Dagegen ist der aktuelle Münchner Opern-Otello ein paralysierter Staubsaugervertreter. Nicht schwarz, nicht weiß, nicht grau. Nur mau.
Der Beitrag Teutonischer Verdi-Schlagabtausch: ein mit Kaufmann, Harteros und Petrenko allzu hochgezüchteter, Erwartungen unterlaufender „Otello“ in München erschien zuerst auf Brugs Klassiker.